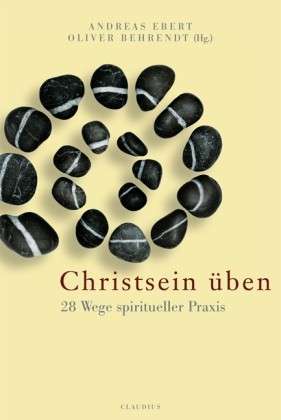Welche Rolle können Kirche und Diakonie konkret vor Ort im Quartier bzw. ganz grundsätzlich in der Zivilgesellschaft spielen? Brigitte Reiser hat hierzu in einem Blogbeitrag aktuelle Literatur zusammengetragen.
In den dort verlinkten Texten entdecke ich zwei Tendenzen, die mir auch schon häufiger in der Debatte um Gemeinwesenorientierung und dem Verhältnis von Kirche/Zivilgesellschaft aufgefallen sind: die kirchlich-selbstreferentielle Behauptung, wie groß das Potenzial der Kirche sei und den Alarmismus, dass die Kirche jetzt ganz schnell Dieses oder Jenes zu tun habe, um nicht völlig von der Bildfläche zu verschwinden.
All dies führt bei mir immer mehr zu dem Eindruck, dass die Diskurse, ob und wie sich Kirche zivilgesellschaftlich ausrichten sollte, letztlich doch recht zäh sind. (Oder liege ich hier falsch?)
Drei Hinweise, wie man die Debatte angehen kann.
Vom Alarmismus zum Presencing
Sehr oft wird behauptet, wie wichtig eine Öffnung der Kirche zum Quartier/zum Gemeinwesen/zur Zivilgesellschaft sei – was ja durchaus richtig ist. Allerdings fällt mir dabei häufig ein alarmierenden und moralisierenden Unterton auf. Alarmismus („Schnell, schnell!“) und Moralismus („Die Kirche ist nicht mehr Kirche, wenn sie nicht…!“) sind in den meisten Fällen schlechte Ratgeber.
Wie kann es gelingen, etwas in Ruhe aber gleichzeitig mit Kraft und Commitment zu tun? Es gibt hier zwar kein Patentrezept, aber zumindest eine Herangehensweise, die ich für sehr vielversprechend halte. Es ist die Theorie U von C. Otto Scharmer. Man muss sich ein bisschen einfuchsen (ich gestehe, dass ich seine Ideen anfangs nicht so recht kapiert habe). Eine wirklich gute Einführung in die Theorie U, noch dazu mit Hinweisen zur kirchlichen Organisationsentwicklung, bietet Karl-Heinz Knöss in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung und Gemeindeberatung (Heft 14, 2014, S- 28-35).
Die Idee: Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen Veränderung stattfinden kann. Bei der gängigen Herangehensweise versucht man von der Herausfordeurng direkt zur Aktion zu kommmen. Doch umso tiefer man in den „U-Prozess“ eintaucht, umso gehaltvoller und nachhaltiger werden die Veränderungsprozesse. Auf der tiefsten Ebene liegt das Presencing – eine Verbindung aus presence (anwesend) und sensing (einfühlend). Das ist das Gegenteil von Aktionismus und gleichzeitig der Grund, aus dem heraus wirklich Neues entstehen kann. Gerade für den kirchlichen Kontext ist die Theorie U wirklich ein wunderbarer Ansatz!
Interessant finde ich auch, dass Scharmer die Ebene, auf dem das Presencing liegt, mit dem Willen in Verbindung bringt. Das führt mich direkt zum nächsten Punkt: dem Wollen.
Weniger Sollen und mehr Wollen
Kirchengemeinden sind verhältnismäßig autonom. Merkwürdigerweise nutzen viele Gemeinden kaum die Chance, selbst zu bestimmen, was sie machen wollen. Man will gar nichts, sondern macht das, was man immer schon gemacht hat. Die Haltung, etwas zu wollen ist in vielen Gemeindeleitungen eher schwach ausgeprägt – dabei werden gerade die Gemeinden, die etwas wollen, als attraktiv wahrgenommen.
Es gibt ein schönes Essay von Ella Luna zu den „Crossroads of Should & Must“: Es geht um den Unterschied zwischen den Dingen, die wir tun sollen und denen, die uns so wichtig sind, dass wir sie einfach tun müssen (Müssen wird hier als etwas Positives verstanden, das man von dem moralisch-appellativen Sollen unterscheiden muss. Ich würde an dieser Stelle daher Ella Lunas „Must“ lieber mit Wollen als mit Müssen übersetzen, um nicht missverstanden zu werden.)
All die Gedanken sind nicht wirklich neu, aber Ella Luna hat sie gut auf den Punkt gebracht. Ihr geht es darum, die eigene Berufung zu finden, aber ich denke, dass man ihre Ideen genauso gut auf kollektive Akteure übertragen kann. Wie wäre es, sich auf einem Gemeindeleitungswochenende einmal an diesem Essay abzuarbeiten: Was sind all die Dinge, die wir als Gemeinde tun sollten und was sind die Dinge, die wir wirklich tun wollen? Und das schließt ausdrücklich ein, sich gegen etwas zu entscheidenn, etwas bewusst nicht zu wollen. In vielen Gemeindekonzeptionen und -leitbildern entdecke ich (viel zu) viel Sollen und (viel zu) wenig Wollen.
Bessere Differenzierung des Erfahrungswissens
Ein gängiger Fehler – der mir auch häufig passiert – ist es, von „der“ Kirchengemeinde zu sprechen. Es gibt aber grundverschiedene Typen von Kirchengemeinden.
Handlungsempfehlungen für die Kirchengemeinde sind daher entweder zu allgemein oder sie treffen für etliche Kirchengemeinden gar nicht zu. Es macht keinen Sinn von der Kirchengemeinde zu sprechen. Andererseits ist es genausowenig sinnvoll, so zu tun, als ob jede der 15.000 evangelischen Gemeinden völlig einzigartig ist. Hilfreich wäre ein gute Gemeinde-Typologie, um das Erfahrungswissen (das es ja zuhauf gibt) besser zu erschließen.
Bislang gibt es wenig Forschung über Kirchengemeinden, daher fehlen entsprechende Theorien und Typologien. Nun hat das SI der EKD im Zuge seines Kirchengemeinde-Barometers eine empririsch gewonnene Typologie entwickelt, die zehn Gemeindetypen unterscheidet. Ich finde sie nicht ganz so griffig, aber sie ist das solideste, was ich kenne. Wie wäre es, wenn man zum Beispiel die Erfahrungen und Empfehlungen der Kirche-findet-Stadt-Projekte nach dieser Typologie (neu) ordnen würde? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur das Erfahrunsgwissen besser systematisiert, sondern auch zu eingen Aha-Effekten führt. Vielleicht zeigt sich ja auch, dass gemeinwesenorientierte Ansätze nur in ganz bestimmten Gemeinde-Typen erfolgreich sind. Auch das wäre ein Fortschritt in der Gemeinwesen-Debatte.
tl;dr
Drei Empfehlungen für die Debatte um kirchliche/diakonische Gemeinwesenorientierung: Alarmismus vermeiden und Presencing entdecken; sich weniger vom Sollen und viel mehr vom Wollen leiten lassen; Erfahrungswissen besser differenzieren.