Der christliche Glaube ist in erster Linie eine Transformationspraxis. Und Praxis braucht Übung. Auch wenn Martin Luther betont hat, dass das Leben „nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung“ sei, ist der Protestantismus wohl auch nicht ganz unschuldig daran, dass christlichen Übungswegen oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das ändert sich in den letzten Jahren (Gott sei Dank!) wieder, gerade auch im evangelischen Bereich.
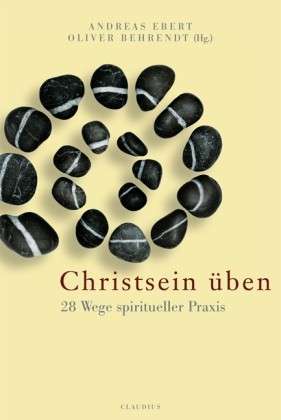 Die beiden Leiter der spirituellen Zentren St. Martin (München) und Eckstein (Nürnberg) in der Bayerischen Landeskirche, Andreas Ebert und Oliver Behrendt, haben ein schönes Büchlein herausgegeben, in dem sie einen Überblick christlicher Übungswege bieten: Christsein üben. 28 Wege spiritueller Praxis. Die Auswahl ist breit, jeder Übungsweg wird auf maximal fünf Seiten kurz skizziert. Man kann blättern und stöbern und entdeckt vielleicht etwas, das man vertiefen möchte. Das Inhaltsverzeichnis kann auch über die Nationalbibliothek eingesehen werden (PDF).
Die beiden Leiter der spirituellen Zentren St. Martin (München) und Eckstein (Nürnberg) in der Bayerischen Landeskirche, Andreas Ebert und Oliver Behrendt, haben ein schönes Büchlein herausgegeben, in dem sie einen Überblick christlicher Übungswege bieten: Christsein üben. 28 Wege spiritueller Praxis. Die Auswahl ist breit, jeder Übungsweg wird auf maximal fünf Seiten kurz skizziert. Man kann blättern und stöbern und entdeckt vielleicht etwas, das man vertiefen möchte. Das Inhaltsverzeichnis kann auch über die Nationalbibliothek eingesehen werden (PDF).
Fasten, Pilgern oder Herzensgebet sind fraglos Übungswege. Trifft das auf die Diakonie ebenso zu? Ja und Nein, ist mein Fazit. Diese Ambivalenz zeigt sich auch schon in dem Titel des Artikels, den der Diakonie-Präsident Bayerns, Michael Bammessel, beigesteuert hat: „Die spirituelle Dimension diakonischen Engagements“.
Michael Bammessel beginnt seine Ausführungen mit der Erzählung von Christopherus: Christopherus ist groß und stark und will einem mächtigen Herren dienen. Er trifft auf einen Einsiedler, der ihm rät, Gott zu dienen. Dazu wären zwei Übungswege erforderlich: Fasten und Gebet. Beides passt nicht so recht zu Christopherus und da schlägt der Einsiedler ihm vor, stattdessen doch Reisende durch eine große Furt zu tragen. Christopherus bekommt also quasi eine diakonische Aufgabe, die er annimmt. Einige Jahre später kommt es dann zu der legendären Christusbegegnung, als er auf einmal in einem Kind, das er auf dem Rücken über den Fluss trägt, Christus erkennt.
„Diese lebenswahre Geschichte hat einen seelsorgerlichen Zug: Nicht jeder spirituelle Übungsweg muss für jeden Menschen geeignet sein. Die überraschende Botschaft: Auch die ganz praktisch ausgeübte Nächstenliebe kann zu einer unvermutet intensiven Gotteserfahrung führen, und zwar gerade dann, wenn die Hilfe ohne weitergehende Absichten gegeben wurde und die religiöse Dimension gar nicht im Blick war“ (S. 44).
Gottes- und Nächstenliebe, spirituelle Übung und tätiges Engagement, sind miteinander verflochten. Darauf möchte Michael Bammessel hinaus, und da kann man natürlich nur zustimmen. Ich möchte an dieser Stelle zwei Arten der Beziehung unterscheiden:
- Die Wechselwirkung von spiritueller Übung und diakonischem Engagement: Das Eine führt zum Anderen (nicht ganz, etwas besser gesagt: das Eine kann zum Anderen führen, muss es aber nicht zwingend).
- Die Balance von spiritueller Übung und diakonischem Engagement: Das Eine braucht das Andere (jedenfalls dann, wenn das Eine in hoher Intensität ausgeführt wird).
Wenn man dies so sieht, dann wird man diakonisches Engagement nur schwer als spirituellen Übungsweg verstehen können. Denn dann ist „Diakonie“ die (Neben-)Bedingung oder die (Neben-)Wirkung eines anderen Übungsweges wie Gebet, Kontemplation, Meditation.
Man kann aber auch aus aus der Erkenntnis, dass sich in diakonischem Engagement eine Christusbegegnung einstellen kann (kann!), eine Übung machen. Selbst wenn ich diese Erfahrung nicht mache, kann ich so tun, als ob mir Christus gegenübersteht:
„In jedem Menschen, dem wir Beistand leisten, ist in geheimnisvoller Weise Christus selbst gegenwärtig. Er ist durch seine Passion, also seinen eigenen Leidensweg, eins geworden mit den Leidenden aller Zeiten. Dieses Wissen gibt jedem diakonischen Engagement eine spirituelle Tiefendimension. Wer es lernt, im anderen Menschen Christus selbst zu sehen, der handelt anders“ (S. 45).
Das wäre dann der diakonische Übungsweg. Absichtslos eine Aufgabe ausführen – ohne eine religiöse Aufladung, ohne die Erwartung, dass etwas „Spirituelles“ dabei passiert – aber in der Haltung, dass der Mensch mir gegenüber Christus ist.
Das Lesen dieses Artikels hatte für mich noch einen weiteren Nebeneffekt, nämlich die Figur des Christopherus stärker in mein diakonisches Blickfeld zu rücken. Ich muss zugeben, dass mir Christopherus als eine diakonische Leitfigur bisher gar nicht so im Sinn war. Leider. Denn es ist eine gute und vor allem sehr passende Geschichte: Auf der Suche sein, was man Sinnvolles tun kann (welchem Herren man dienen will). Eine konkrete Aufgabe ausführen und damit von Nutzen sein. Keine weiteren Absichten damit verbinden. Punkt. Und das Christliche daran? Nun, ob Christopherus religiös war oder nicht, spielt keine tragende Rolle und sein Fährmanndienst zu Fuß kann wohl kaum als religiöse Tat dargestellt werden. Eines Tages begegnet ihm im Anderen Christus, aber völlig unerwartet. All das trifft den Kern diakonischen Engagement (bzw. die Lebenswirklichkeit von Diakonie-Mitarbeitenden) doch wesentlich besser als das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Oder?
P.S.: Während ich dies tippe, sitze ich im Zug nach München, um an dem Symposium zum Herzensgebet (PDF) teilzunehmen, das von den beiden Herausgebern dieses lohnenden Büchleins veranstaltet wird.
tl;dr
Diakonisches Engagement und spirituelle Übung sind eng miteinander verbunden. Diakonische Praxis und geistliche Übung brauchen einander. Man kann aus den Erfahrungen diakonischen Engagements auch eine christliche Übung ableiten: Christus im Anderen sehen (wollen).
Andreas Ebert/Oliver Behrendt (Hg.): Christsein üben. 28 Wege spiritueller Praxis, München 2012. 14,80 Euro. Darin: Michael Bammessel: Die spirituelle Dimension diakonischen Engagements, S. 44-48.